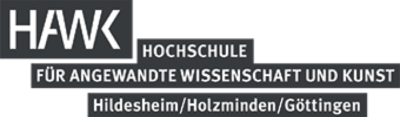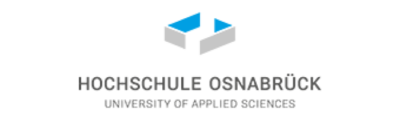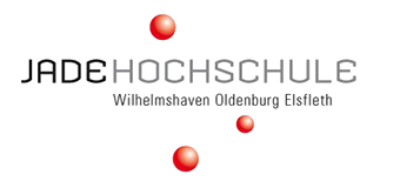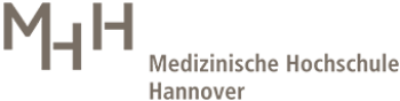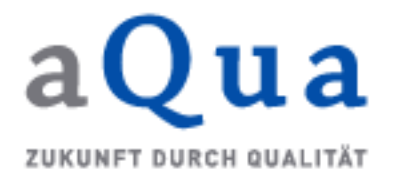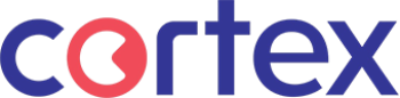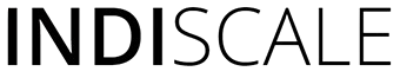Zukunftslabor Gesundheit
Die medizinische Forschung und Gesundheitsversorgung stehen durch die zunehmende Digitalisierung vor einem grundsätzlichen Umbruch. Grundlegende Fortschritte in der Sensorik und Bildgebung im klinischen Alltag sowie privaten Umfeld liefern neue Daten. Die transsektorale Vernetzung von Versorgungsdaten verknüpft die episodischen Datensätze zu heterogenen Datensätzen, welche mittelfristig die gesamte Lebensspanne umfassen. Neue Datenanalyse-Technologien für große Datenmengen ermöglichen neuartige Ansätze für das Verständnis und die Therapie von Erkrankungen. Dabei handelt es sich nicht um den einfachen Einsatz von Technologien, sondern um grundlegende Veränderungen der Gesundheitsversorgung, die sich in einer individuelleren Versorgung, neue telemedizinische Angebote und neue Marktteilnehmer darstellen.
Zentrale Aspekte sind der Einsatz neuer digitaler Methoden in Versorgung und Pflege, eine evidenz- und datenbasierte Medizin, die Gestaltung gesundheitsfördernder Lebenswelten, smarte Implantate und neuartige (Bio-)Sensorik, eine personalisierte Medizin sowie umfassende Versorgungsforschung entlang der gesamten Versorgungskette. Besonders bedeutend sind die Schwerpunkte translationale Medizin, Versorgung in der Fläche, individuelle Prävention im Sinne einer gesunden Lebensplanung. Es bedarf auch einer Weiterentwicklung von Ausbildung und Lehre zur notwendigen Kompetenzvermittlung.
Wissenschaftler*innen

Jannik Fleßner
Jannik Fleßner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Jade Hochschule Wilhelmshaven, Oldenburg, Elsfleth in der Abteilung Technik und Gesundheit für Menschen. Seine Forschungsschwerpunkte sind: Mensch-Maschine Interaktion, Expertensysteme, Smart Home, Künstliche Intelligenz.
Projekte
Entwicklung einer Forschungsplattform zur umfassenden Bereitstellung medizinischer Daten, die von verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen erzeugt werden
Entwicklung sensorbasierter Technologien, zur Ermöglichung telemedizinischer Versorgung und Verfügbarkeit assistierender Gesundheitstechnologien
Ziel des Projektes ist die Vermittlung von Forschungsergebnisse des Zukunftslabors in Form von Online-Kursen an relevante Zielgruppen im Gesundheitswesen

Dr.-Ing. Sandra Hellmers
Dr.-Ing. Sandra Hellmers ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Assistenzsysteme und Medizintechnik an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Bewegungserfassung und -analyse mit optischen, tragbaren sowie ambienten Sensoren. Zudem untersucht sie Veränderungen in Bewegungsabläufen als Reaktion auf (robotische) Assistenzsysteme.
Projekte
Primary prevention for healthy ageing
Primary prevention for healthy ageing II
Entwicklung integrierter technikgestützter und umsetzungsorientierter Konzepte zur salutogenen Arbeitsprozessgestaltung
Bewertung der ethischen Akzeptabilität und der sozialen und technologischen Aspekte von co-intelligenten Sensor- und Assistenzsystemen in der Pflege von Demenzerkrankten
Optimierte, individualisierte Bewegungstherapie durch die Interaktion künstlicher Intelligenz und Videotechnik mit Healthcare Professionals und Patienten

Jens Hüsers
Jens Hüsers ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Informatik im Gesundheitswesen an der Hochschule Osnabrück. Er befasst sich mit der IT-gestützten Versorgung von chronischen Wunden. Dazu zählen auf KI basierte Entscheidungsunterstütztungssysteme. Zudem lehrt er in den Bachelor und Masterstudiengängen der Gesundheitsfachberunfe empirische Sozialforschung und quantiative Methoden. Zuzeit enwickelt er zusammen mit seinen Kollegen und Kolleginnen das Medizinische Inforamtionsobjekt "Überleitungsbogen chronische Wunde" in Zusammenarbeit mit der MIO42 GmbH.
Projekte
Bereitstellung prozessbezogener und kontextsensitiver Entscheidungsunterstützung sowie Simulation zur Therapieunterstützung am Beispiel chronischer Wunden
Entwicklung und Erprobung einer auf wissenschaftlichen Grundlagen basierende Methodologie für Innovationsmanagement innerhalb des eHealth-Umfeld
Aufbau von forschungsförderlichen Strukturen und der Entwicklung von institutionalisierten Beziehungen zu den Gesundheitseinrichtungen in der Region
The European eHealth Programme in Higher Education (eHealth4all@EU) addresses the demand for health professionals to be competent and confident in eHealth

Matthias Katzensteiner
Matthias Katzensteiner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Hochschule Hannover an der Fakultät III für Information und Kommunikation. Seine Forschungsschwerpunkte sind: Datenmodellierung, Datenintegration, Didaktik und Online-Lehre.
Projekte
Entwicklung eines Diagnostikums und begleitend eines Expertensystems für die frühzeitige Erkennung der Abstoßungen bei nierentransplantierten Patienten

Jendrik Richter
Jendrik Richter ist wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Medizinische Informatik an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG). Seine Forschungsschwerpunkte sind: Interoperabilität im Gesundheitswesen, Datenaustauschstandards und Datentransformation (ETL), Klinische Entscheidungsunterstützungssysteme - Entwicklung, Dokumentation und Bewertung
Projekte
Ziel des Projektes ist die Vermittlung von Forschungsergebnisse des Zukunftslabors in Form von Online-Kursen an relevante Zielgruppen im Gesundheitswesen
Entwicklung sensorbasierter Technologien, zur Ermöglichung telemedizinischer Versorgung und Verfügbarkeit assistierender Gesundheitstechnologien
Entwicklung einer Forschungsplattform zur umfassenden Bereitstellung medizinischer Daten, die von verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen erzeugt werden
Bereitstellung prozessbezogener und kontextsensitiver Entscheidungsunterstützung sowie Simulation zur Therapieunterstützung am Beispiel chronischer Wunden

Daniel Thole
Daniel Thole ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medizinische Informatik der Universitätsmedizin Göttingen. Er ist als Koordinator des Zukunftslabors Gesundheit tätig. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Nachhaltigkeit von Projekten im Gesundheitswesen.
Projekte
Aufbau einer Plattform für die nachhaltige Koordination von Best Practices und dem Einsatz von Pandemieapps nach dem Stand der Wissenschaft und Technik
Smarte Unterstützung für ärztliche Entscheidung und Verbesserung der Voraussetzungen für eine zeitnahe, zielgerichtete Diagnostik und initiale Therapie

Stefan Vogel
Stefan Vogel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medizinische Informatik in Göttingen Universitätsmedizin Göttingen Seine Forschungsschwerpunkte sind: Klinische Entscheidungsunterstützungssysteme und Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen nsowie Software als Medizinprodukt
Projekte
Smarte Unterstützung für ärztliche Entscheidung und Verbesserung der Voraussetzungen für eine zeitnahe, zielgerichtete Diagnostik und initiale Therapie
Potenziale KI-gestützter und präzisierter Vorhersageverfahren auf Basis von Routinedaten im Rahmen der gesundheitlichen Risiken der Patienten*innen
Entwicklung von nachhaltig einsetzbaren, skalierbaren und auf zukünftige Pandemien übertragbaren Surveillance- und Teststrategie sowie deren Erprobung
Aufbau einer Plattform für die nachhaltige Koordination von Best Practices und dem Einsatz von Pandemieapps nach dem Stand der Wissenschaft und Technik
Durch medizininformatische Lösungen und übergreifenden Datenaustausch klinische und Patientenversorgung effizienter zu gestalten und zu verbessern.
Bereitstellung prozessbezogener und kontextsensitiver Entscheidungsunterstützung sowie Simulation zur Therapieunterstützung am Beispiel chronischer Wunden
Geförderte Einrichtungen
Projekte des Zukunftslabors
News
Videos und Podcasts
Wissenschaftliche Veröffentlichungen
To develop a decision support system for pediatric cardiology case conferences, the anonymization of 4,000 freetext medical case reports is required. This paper presents an anonymization strategy usin ...
To develop a decision support system for pediatric cardiology case conferences, the anonymization of 4,000 freetext medical case reports is required. This paper presents an anonymization strategy using LLM-AIx, a tool for structured information extraction based on large language models (LLM). The three-step process involves automatic extraction of personally identifiable information (PII) from the reports, evaluation of the results against a manually annotated ground truth, and replacement of identified PII with surrogate values, including controlled date shifting. Initial tests with six example reports revealed challenges regarding handling multiple attribute occurrences and consistent replacements. Future work will focus on full pipeline implementation and mapping clinical information to standardized terminologies such as SNOMED CT.
Autor*innen
- Darian Liehr (Hochschule Hannover)
- Dr. med. Theodor Uden
- Prof. Dr. Christian Wartena
- Prof. Dr. Volker Ahlers
- Prof. Dr.-Ing. Steffen Oeltze-Jafra (Technische Universität Braunschweig, Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik)
- Prof. Dr. med. Dr.-Ing. Michael Marschollek (Leibniz Universität Hannover, Forschungszentrum L3S)
- Prof. Dr. med. Philipp Beerabaum
- Prof. Dr.-Ing. Oliver J. Bott (Hochschule Hannover, Abteilung Information und Kommunikation)
Veröffentlichung
- Im Rahmen des Buches/Journals bzw. Konferenz: KI-Forum 2025 : KI in Forschung und Lehre an Hochschulen 2025
- Datum: 01.12.2025
Die Nutzung elektronischer Patientenakten (ePA) zur Datenspende bietet großes Potenzial für die medizinische Forschung, stellt jedoch hohe Anforderungen an Information, Kommunikation und Akzeptanz in ...
Die Nutzung elektronischer Patientenakten (ePA) zur Datenspende bietet großes Potenzial für die medizinische Forschung, stellt jedoch hohe Anforderungen an Information, Kommunikation und Akzeptanz in der Bevölkerung. Im Rahmen eines interdisziplinären Workshops anlässlich der 69. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. diskutierten in Dresden Expert:innen aus Medizinischer Informatik, Wissenschaftskommunikation und Patientenvertretung gemeinsam mit dem Publikum zentrale Fragestellungen zur Kommunikation der Datenspende an Bürger:innen.
Ziel war es, Bedingungen zu identifizieren, unter denen eine informierte und selbstbestimmte Entscheidung über die freiwillige Nutzung von Gesundheitsdaten für Forschungszwecke möglich ist. Im Fokus standen dabei die Fragen, wer über die Datenspende informiert, wie Vertrauen in Institutionen gestärkt, Nutzen und Risiken verständlich vermittelt und Zielgruppen angemessen erreicht werden können. Impulsvorträge und Diskussionen zeigten, dass es einer Vielzahl niedrigschwelliger, transparenter und zielgruppengerechter Informationsangebote durch glaubwürdige Akteure bedarf. Dabei gilt es, digitale Gesundheitskompetenz zu fördern, Zugangshürden abzubauen und Bürger:innen nicht nur technisch, sondern auch kommunikativ zu befähigen.
Der Beitrag verdeutlicht, dass eine wirksame Kommunikation zur Datenspende eine zentrale Voraussetzung für gesellschaftliche Akzeptanz und eine gerechte Teilhabe an digitaler Gesundheitsforschung darstellt.
Autor*innen
- Prof. Dr.-Ing. Oliver J. Bott (Hochschule Hannover, Abteilung Information und Kommunikation)
- Dr. Nicole Egbert (Netzwerk Versorgungskontinuität in der Region Osnabrück e.V.)
- Saskia Kröner
- Stefan Rühlicke (Georg-August-Universität Göttingen, Universitätsmedizin Göttingen, Institut für Medizinische Informatik)
- Björn Schreiweis
- Brigitte Strahwald (Ludwig-Maximilian Universität)
- Veronika Strotbaum
- Martin Wiesner
Veröffentlichung
- Im Rahmen des Buches/Journals bzw. Konferenz: GMS Med Inform Biom Epidemiol
- Datum: 28.11.2025
The 24th Special Topic Conference (STC 2025) of the European Federation for Medical Informatics (EFMI) was held in Osnabrück, Germany from 20–22 October 2025. The Conference was co-hosted by Osnabrück ...
The 24th Special Topic Conference (STC 2025) of the European Federation for Medical Informatics (EFMI) was held in Osnabrück, Germany from 20–22 October 2025. The Conference was co-hosted by Osnabrück University of Applied Sciences, the German Society of Medical Informatics, Biometry and Epidemiology (GMDS) and EFMI.
The theme of STC 2025 was “Good Evaluation – Better Digital Health”. In an era of rapid digital transformation, the conference highlighted that rigorous evaluation is essential to ensure the safety, effectiveness and sustainability of health IT innovations. While evaluation is often carried out at the very end of the development process, good evaluation starts at the outset of a project with an investigation of the context within which the implementation will take place and its determinants. In the best case, the evaluation will follow a longitudinal approach to capture the full impact of the implementation regardless of whether it is positive or negative. With the advent of powerful digital systems, including those making use of AI technology, evaluation is needed more than ever to prevent harm and ensure effectiveness and meaningfulness on a micro, meso and macro level. As digital interventions have multiple determinants and implications, evaluation methods have to consider the full spectrum of dimensions, ranging from technical and organisational aspects to human, social, ethical and
educational perspectives.
These proceedings present current scientific trends in the evaluation of digital health and AI-enabled systems in patient care. Some contributions address methodological topics such as evaluation paradigms and techniques, research models and frameworks that constitute the foundation of reliable and valid results. Others point to critical areas of investigation such as technical quality, including interoperability, as well as data protection and security. Non-technical areas of paramount importance, first and foremost ethics, are equally addressed. Many papers take the perspective of human and organisational factors combined with social and political aspects in their dual role as potential determinants and outcomes. Finally, educational aspects are covered by a number of papers addressing competencies and tools for enhancing education in the era of AI.
While these topics have been scientifically investigated by biomedical and health informatics for many decades, the latest AI developments impose a new imperative on the evaluation of digital health. These proceedings reflect the current debates and developments from a scientific point of view with the goal of having an impact on practice.
The proceedings are published by IOS Press in the series Studies in Health Technology and Informatics. Volumes in this series are submitted (for evaluation) for indexing by MEDLINE/PubMed; Web of Science: Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S) and Book Citation Index – Science (BKCI-S); Google Scholar; Scopus; and EMCare.
Autor*innen
- Prof. Dr. rer. nat. Ursula Hertha Hübner (Hochschule Osnabrück, Forschungsgruppe Informatik im Gesundheitswesen)
- Prof. Dr. Jan-David Liebe (Medizinische Hochschule Hannover)
- Arriel Benis
- Dr. Nicole Egbert (Netzwerk Versorgungskontinuität in der Region Osnabrück e.V.)
- Thomas Engelsma
- Parisis Gallos
- Daniel Flemming
- Valentina Lichtner
- Romaric Marcilly
- Oscar Tamburis
- Sidsel Villumsen
Veröffentlichung
- Im Rahmen des Buches/Journals bzw. Konferenz: Proceedings of the EFMI STC 2025 Conference.
- Datum: 20.10.2025 - 22.10.2025
Wissenschaftliche Vorträge
Referent*innen
- Prof. Dr. rer. nat. Ursula Hertha Hübner (Hochschule Osnabrück, Forschungsgruppe Informatik im Gesundheitswesen)
Vortrag
- Im Rahmen der Veranstaltung: E-Sundhedsobservatoriet 2025 Conference Odense, Dänemark
- Datum: 08.10.2025
Referent*innen
- Darian Liehr (Hochschule Hannover)
- Dr. med. Theodor Uden
- Prof. Dr. Christian Wartena
- Prof. Dr. Volker Ahlers
- Prof. Dr.-Ing. Steffen Oeltze-Jafra (Technische Universität Braunschweig, Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik)
- Prof. Dr. med. Dr.-Ing. Michael Marschollek (Leibniz Universität Hannover, Forschungszentrum L3S)
- Prof. Dr. med. Philipp Beerabaum
- Prof. Dr.-Ing. Oliver J. Bott (Hochschule Hannover, Abteilung Information und Kommunikation)
Vortrag
- Im Rahmen der Veranstaltung: KI-Forum 2025 : Veranstaltung der Hochschule Hannover am 16.09.2025
- Datum: 16.09.2025
Referent*innen
- Annette Günther
- Prof. Dr.-Ing. Oliver J. Bott (Hochschule Hannover, Abteilung Information und Kommunikation)
- Prof. Dr. Andreas Büchner
Vortrag
- Im Rahmen der Veranstaltung: 70. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. (GMDS) vom 7. bis 11. September in Jena
- Datum: 10.09.2025